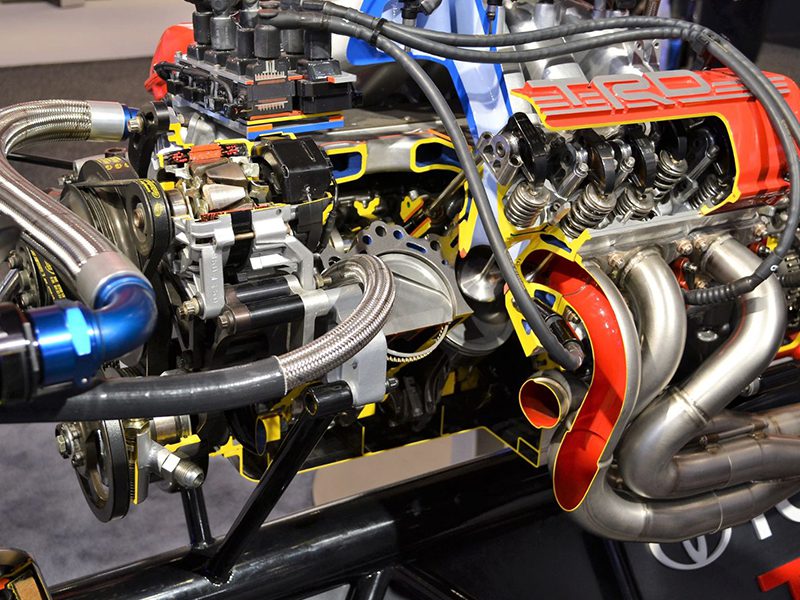Es würde das erste Haus sein, das Jonas und seine Frau Sabrina gemeinsam kaufen würden. Beide hatten genügend Geld angesammelt, um das Haus schließlich kaufen zu können. Die beiden sahen es als ihr ideales Zuhause an. Es war geräumig und verfügte über einen Garten im Hinterhof, den sie für ihre zukünftigen Kinder nutzen konnten. Doch schon bald mussten sie feststellen, dass ihr ideales Haus der Stoff war, aus dem Albträume gemacht sind.
Jonas Keller und Sabrina Keller waren seit fünf Jahren verheiratet, als sie die Entscheidung trafen, das Haus ihrer Träume zu kaufen. Zusammen mit ihrem Hund Scout beschlossen sie, Pittsburgh, Pennsylvania, zu ihrem dauerhaften Zuhause zu machen. Schließlich konnten sie etwas finden, das sie beide zufriedenstellte, auch wenn es sehr lange dauerte. Andererseits konnte Sabrina ihre Aufregung nicht zurückhalten, als sie das Haus besichtigten und es von innen sahen. Doch die Freude des Paares wurde schon bald von Wehmut abgelöst.
Als der Tag ihres Umzugs näher rückte, hatten Jonas und Sabrina bereits alle ihre Sachen aus der Wohnung, die sie gemietet hatten, zusammengetragen. Sie waren überglücklich, dass sie in diesem Moment ausziehen konnten. Trotz der Tatsache, dass sie nur ein paar Kartons hatten, nahmen sie sich vor, ihr neues Haus mit allem zu füllen, was sie sich wünschten und liebten, um es zu einem Ort zu machen, an dem sie sich wohl fühlen würden. Sobald sie das Gebäude durch den Vordereingang betraten, bot sich ihnen ein außergewöhnlicher Anblick.
Als sie sahen, wie viel Platz sie hatten, konnten sie es nicht glauben. Es war ein zweistöckiges Gebäude, und alle Schlafzimmer befanden sich im zweiten Stock. Neben der Küche und dem Wohnzimmer befand sich auch das Arbeitszimmer im Erdgeschoss. Sabrina freute sich sehr, endlich eine Küche zu haben, die groß genug war, um alle ihre Lieblingsgerichte zuzubereiten. Plötzlich wurde sie auf eine merkwürdige Begebenheit aufmerksam. In der Küche gab es eine Bodenluke, die existierte. Als die Immobilienmaklerin sie auf eine Tour durch das Haus mitnahm, war sie ihr bis dahin nicht aufgefallen. Vielleicht lag es daran, dass ein Tisch darauf stand.
Andererseits bemerkte sie, dass er mit einem Schloss und Riegeln gesichert war. Nachdem sie es Jonas gezeigt hatten, entwickelten sie eine Strategie, um zu versuchen, es zu öffnen, um zu sehen, was unter dem Küchenboden verborgen war. Sabrina sah, dass hinter einem antiken Schrank etwas versteckt war, das der Vorbesitzer während ihrer Zeit dort zurückgelassen hatte. Es war nicht zu leugnen, dass Scout sich dabei unwohl fühlte, was sich in seinem Knurren zeigte. Ein Immobilienmakler gab an, dass das Haus einer älteren Frau gehörte, die keine Nachkommen hatte, an die sie das Haus weitergeben konnte. Obwohl der antike Schrank nicht unansehnlich war, kam Sabrina zu dem Schluss, dass er einen neuen Anstrich brauchte. Nachdem sie den Schrank ein wenig verschoben und dann noch einmal verschoben hatte, machte sie eine merkwürdige Entdeckung.
Nach einigen Wochen bemerkten Jonas und Sabrina, dass Max jeden Tag an derselben Wand schnüffelte und schließlich anfing, sie anzubellen. Zuerst hielten sie es für eine seiner seltsamen Gewohnheiten, doch als es schlimmer wurde, beschlossen sie, einen Handwerker zu rufen. Als dieser die Wand öffnete, kam Erstaunliches zum Vorschein: Zwischen den Wänden hatten sich mehrere Eichhörnchen eingenistet. Sie hatten dort ganze Berge von Tannenzapfen gesammelt, die sie vom nahegelegenen Wald herangeschleppt hatten. Das Paar war gleichermaßen schockiert und erleichtert – endlich wussten sie, warum ihr Hund sich so merkwürdig verhalten hatte.